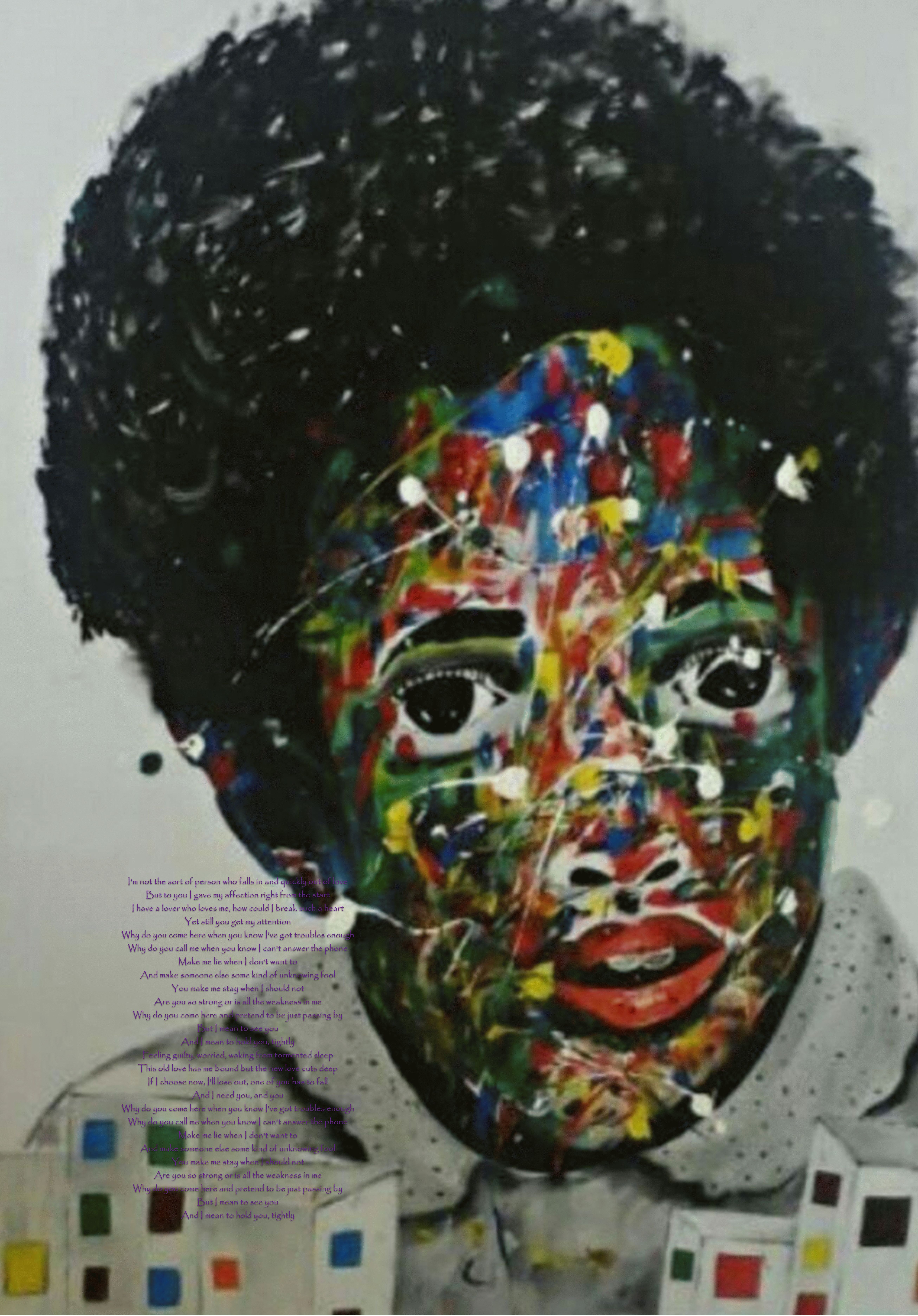Mr. Turkey: «Irgendwo sind sicher noch Zigaretten vorhanden; in der Schublade, im Küchenschrank, unter dem Bett…»
Me: «Hm, glaubst du?»
Mr. Turkey: «Schau mal in den Manteltaschen nach. Vielleicht ist dort noch eine Zigarette.»
Me: «Come on, dort schaut man doch zuerst.»
Mr. Tukrey: «Du könntest mit Deiner Tochter Kaffee trinken gehen. Sie raucht ja.»
Me: «Ja, aber das wäre unfair, da ich so meine Tochter nur der Zigaretten wegen sehen würde.»
Mr Turkey: «Du könntest zum indischen Laden gehen, eine Schachtel Zigaretten kaufen, und ihm sagen, er soll die Schachtel behalten, und dir jedesmal nur eine Zigarette geben, wenn du den Laden betritts.»
Me: «Mach dich nicht lächerlich.»
Mr Turkey: «Geh zum Bahnhof und frage dort einen Raucher nach einer Zigarette. Erinnere dich, an wievielen Leuten du schon Zigaretten verschenkt hast.»
Me: «Naja, geben ist seeliger als nehmen.»
Mr Turkey: «Geh doch Daniele mal besuchen, mach eine Sumpftour mit ihm und begrabe würdig die Hektaren Tabakfelder, die du konsumiert hast.»
Me: «Naja, Dan und die Idee in Ehren, aber man muss den Tatsachen nüchtern ins Auge sehen.»
Mr Turkey: «Wie wäre es mit einer Belohnung? Erster Tag ohne Zigaretten, so ein Biercben und vielleicht ein Glimmstengel?»
Me: «Du nervst!»
the end of laughter
Exzessives Rauchen verursacht verschiedene Krankheitsbilder:
- Lungenkrebs:
Jährlich erkranken in der Schweiz knapp 4300 Menschen an Lungenkrebs, das sind knapp 11% aller Krebserkrankungen. Gut 60% der Betroffenen sind Männer, knapp 40% Frauen. Lungenkrebs ist bei Männern die zweithäufigste, bei Frauen die dritthäufigste Krebsart. Lungenkrebs fordert mit 3200 Todesfällen pro Jahr die meisten Krebstodesopfer. Rauchen ist der wichtigste Risikofaktor für Lungenkrebs. In Europa werden rund 80% aller Fälle von Lungenkrebs durch Rauchen verursacht. Der Tabakrauch schadet aber nicht nur den Raucherinnen und Rauchern selbst – auch Passivrauchen erhöht das Risiko für Lungenkrebs. - chronische Bronchitis:
Die chronische Bronchitis gehört zu den häufigsten Atemwegserkrankungen. Der anhaltende Husten betrifft hauptsächlich Raucher und kann ernste Folgen haben.
Wie die akute Bronchitis zeigt sich auch die chronische Bronchitis durch Husten mit Auswurf, der aber länger andauert. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Bronchitis dann chronisch, wenn der schleimige Husten innert drei Monaten an fast allen Tagen erscheint und das in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Die chronische Bronchitis kann sich zu einer chronischen obstruktiven Lungenerkrankung (COPD, engl.: chronic obstructive pulmonary disease) entwickeln. Sie zählt zu den häufigsten Todesursachen. Der Übergang ist fliessend.
An chronischer Bronchitis leiden vorwiegend Raucher. Doch auch Umweltfaktoren, Abgase, berufliche Umstände, häufige Atemwegsinfekte oder chronische Nasennebenhöhlenentzündungen können zu einer chronischen Bronchitis führen. - Atemnot:
Atemnot ist Zeichen eines Luftmangels in den Lungen. Sie führt zu einem Sauerstoffmangel und den damit verbundenen Symptomen wie Schwindel, Übelkeit und Unruhe. Der medizinische Ausdruck für Atem- oder Luftnot ist Dyspnoe. - Kehlkropfkrebs:
In der Schweiz erkranken pro Jahr knapp270 Menschen an Kehlkopfkrebs. Männer sind viel häufiger betroffen als Frauen: 85% der Patienten sind Männer, 15% Frauen. Ab dem 50. Lebensjahr steigt das Risiko für Kehlkopfkrebs stark an. Etwas mehr als die Hälfte der Patienten sind zum Zeitpunkt der Diagnose 50 bis 69 Jahre alt, gut 40% sind 70 Jahre oder älter.
Der wichtigste Risikofaktor für Kehlkopfkrebs ist das Rauchen. Auch der regelmässige Konsum von Alkohol erhöht das Krebsrisiko. Besonders hoch ist das Risiko bei Personen, die sowohl rauchen als auch viel Alkohol trinken. - Mundhöhlenkrebs:
Jährlich erkranken in der Schweiz rund 1100 Menschen an Krebs der Mundhöhle oder des Rachens. Das macht knapp 3% aller Krebserkrankungen aus. Fast 70% der Patienten sind Männer, gut 30% sind Frauen. Mundhöhlenkrebs kann auch jüngere Menschen treffen: 10% der Patienten sind zum Zeitpunkt der Diagnose unter 50, gut 55% sind 50 bis 69 Jahre alt.
Es gibt keine eindeutige Ursache für Mundhöhlenkrebs. Einige Faktoren können aber das Erkrankungsrisiko erhöhen.
Sowohl der regelmässige Konsum von Alkohol – besonders von hochprozentigen Getränken – und das Rauchen gelten als die wichtigsten Risikofaktoren, an Mundhöhlenkrebs zu erkranken. Besonders hoch ist das Risiko bei Personen, welche regelmässig Alkohol trinken und rauchen. - Luftröhrenkrebs:
Ein Tracheakarzinom (auch Trachealkarzinom genannt), also Luftröhrenkrebs, ist eine sehr selten auftretende Tumor-Art, die in die Kategorie der Kopf- und Hals-Tumore eingeordnet wird. In der Regel treten epidermoide Tumore auf; in weiterer Folge kann sich ein Adenokarzinom bilden. Beim Luftröhrenkrebs handelt es sich selten um einen primären Tumor; in der Regel ist der Luftröhrenkrebs ein sekundärer Tumor, der durch eine bereits bestehenden Krebserkrankung ausgelöst wurde (Streuung).
Ein Tracheakarzinom kann durch verschiedene Gründe entstehen. Vor allem Raucher sind gefährdet, daran zu erkranken. Tabak und krebserregende Inhaltsstoffe begünstigen, so die Forscher, die Entstehung von Luftröhrenkrebs. Auch der übermäßige Konsum von hochprozentigem Alkohol kann mitunter als Auslöser in Frage kommen. Weitere schädliche Stoffe sind Auto-Abgase, Asbest, radioaktive Substanzen oder auch Arsen. - Speiseröhrenkrebs:
Pro Jahr erkranken in der Schweiz rund 570 Menschen an Krebs der Speiseröhre, das entspricht gut 1% aller Krebserkrankungen. Drei Viertel der Betroffenen sind Männer, ein Viertel Frauen. Speiseröhrenkrebs tritt vorwiegend in höherem Alter auf: 47% der Betroffenen sind zum Zeitpunkt der Diagnose 50 bis 69 Jahre alt, fast 50% sind 70 Jahre oder älter.
Es gibt keine eindeutige Ursache für Speiseröhrenkrebs. Verschiedene Faktoren erhöhen allerdings das Risiko, an Speiseröhrenkrebs zu erkranken. Dazu gehören beispielsweise Rauchen, erhöhter Alkoholkonsum und Übergewicht.
Auch wer jahrelang stark unter saurem Aufstossen und Sodbrennen (Refluxkrankheit) leidet, hat ein erhöhtes Risiko für Speiseröhrenkrebs. Deshalb sollten Sie solche Beschwerden frühzeitig vom Arzt abklären und behandeln lassen. - Herzinfarkt:
Der Herzinfarkt ist eine Notfallsituation. Bei einem Herzinfarkt liegt ein teilweiser oder kompletter Verschluss eines Herzkranzgefässes vor, wodurch Teile des Herzmuskels keinen Sauerstoff erhalten und nach kurzer Zeit absterben. Der Herzinfarkt ist lebensbedrohlich, weshalb rasch reagiert werden muss. Die Ursache dafür ist meist eine koronare Herzkrankheit.
Bestimmte Faktoren sind zwar keine direkten Herzinfarkt-Ursachen, erhöhen aber das Infarkt-Risiko. Dazu gehören vor allem Risikofaktoren, welche die oben beschriebenen Ablagerungen an der Innenwand der Herzkranzgefäße (Arterienverkalkung oder Arteriosklerose) begünstigen. Es handelt sich also um Risikofaktoren für eine Koronare Herzkrankheit, die indirekt eine Herzinfarkt auslösen können.
Manche dieser Risikofaktoren lassen sich nicht beeinflussen. Dazu zählen zum Beispiel höheres Alter und männliches Geschlecht. Gegen andere Risikofaktoren kann man aber sehr wohl etwas tun (etwa gegen Übergewicht und fettreiche Ernährung). Allgemein gilt: Je mehr der unten genannten Risikofaktoren ein Mensch aufweist, desto höher ist sein Herzinfarkt-Risiko, u.a. Rauchen: Stoffe aus dem Tabakrauch fördern die Bildung instabiler Plaques, die leicht aufbrechen können. Zudem verengen sich beim Rauchen jeder Zigarette die Blutgefäße, auch die Herzkranzgefäße. Die meisten Patienten, die vor dem 55. Lebensjahr einen Herzinfarkt erleiden, sind Raucher. - Kreislaufprobleme:
Fast jeder kennt zumindest einzelne Symptome für einen geschwächten Kreislauf – wie Schwindel, Schwarzwerden vor den Augen oder Schweissausbruch bis hin zum Gefühl, das Bewusstsein zu verlieren. Solche Kreislaufbeschwerden sind auf eine verminderte Durchblutung des Gehirns zurückzuführen, deren Ursache ein zu niedriger Blutdruck (sog. Hypotonie) ist. - Gefässerkrankungen:
Unter Gefässerkrankungen versteht man pathologische (krankhafte) Veränderungen der Arterien, Venen oder Lymphgefässe. Diese Veränderungen können den Blutstrom in den Gefässen einschränken oder im schlimmsten Fall ganz blockieren und dadurch schwere Funktionsstörungen in den betroffenen Körperregionen auslösen. Weil sie zu Anfang häufig ohne grössere Beschwerden verlaufen, werden Gefässerkrankungen in manchen Fällen nicht rechtzeitig erkannt. - Alterung der Haut
- embryonale Schädigung:
Bei Raucherinnen und ihren Kindern ist das Risiko einer Fehlgeburt erhöht, das Risiko einer Frühgeburt doppelt so hoch, das Risiko einer Totgeburt doppelt bis dreifach so hoch, das Risiko einer Thrombose in der Schwangerschaft oder später im Wochenbett doppelt so hoch, das Risiko des plötzlichen Kindstods (SIDS) dreifach erhöht.
Weil…
Warum rauchen wir?
- Weil es zur Gewohnheit geworden ist
- Weil ich oft im Stress bin und mich Rauchen beruhigt
- Weil ich den Geschmack geniesse
- Weil ich es nicht schaffe, mit dem Rauchen aufzuhören
- Weil es mir langweilig ist
- Weil Kollegen und Freunde rauchen
- Weil ich oft nicht weiss, wohin ich sonst mit meinen Händen soll
- Weil es mir das Gefühl von Freiheit gibt
- Weil ich ohne rauchen an Gewicht zunehmen würde
- Weil ich dadurch leistungsfähiger bin
- Weil man als Raucher eine bessere Ausstrahlung hat
- Weil rauchen cool ist
- Weil ich überzeugt bin, dass Rauchen mir selber nicht schadet
Fragekatalog, der Jugendlichen gestellt wurde
Natürlich gibt es auch die lakonischen Anworten wie
- Berühmte Leute (naja, nicht jeder, der raucht, wird auch berühmt)
- Traumfigur (hm, was meint dein Spiegel?)
- Morgenverdauung (?)
- Nur die Besten sterben jung (hoffen wir doch nicht)
- Kommunikation (äh, mit der Zigarette im Mund?)
- Hollywood (wie starb schon wieder Humphrey Bogart?)
- Fuck you, Spießergesellschaft! (niemand kümmerts, wie du lebst)
- Werbung (leider wahr)
So allgemein lässt sich das wohl nicht beantwortem; jeder sollte selber die eigene Geschichte dazu finden.
Raucherwaren
Die wichtigsten Tabakprodukte sind:
- Zigaretten: «Zigaretten werden aus fermentierten, getrockneten und feingeschnittenen Blättern der Tabakpflanze hergestellt. Oftmals enthalten sie homogenisierten Tabak (bestehend aus feingemahlenem Tabak und Bindemittel) und Zusatzstoffe z. B. zur Feuchthaltung und zur Aromatisierung. «
- Tabak zum Selbstdrehen von Zigaretten: «Feinschnitt-Tabak besteht aus einer Mischung verschiedener Tabaksorten, die fein geschnitten ist. Die Schnittbreite liegt in der Regel zwischen 0,3 und 0,65 mm. Feinschnitt wird durch den Konsumenten selbst von Hand oder mit einer kleinen Tabakdrehmaschine mit Zigarettenpapier umwickelt. Daneben können Zigaretten aus Feinschnitt auch mit Hilfe von Stopfgeräten und Zigarettenfilterhülsen gefertigt werden.»
- Zigarren und Zigarillos: «Zigarren/Zigarillos werden ebenfalls aus verschiedenen Tabaksorten hergestellt. Die Tabakeinlage wird von einem Umblatt zusammengehalten und schließlich noch vom äußeren Deckblatt umhüllt. Für Zigarillos wird häufig als Umblatt und teilweise auch als Deckblatt homogenisierter Tabak verwendet.
Homogenisierter Tabak wird auch als rekonstituierter Tabak, oder Bandtabak oder Tabakfolie bezeichnet. Das Produkt besteht überwiegend aus kleingemahlenen Tabakteilen und Bindemitteln, die zu einem Band ausgewalzt werden. Bandtabak weist eine gleichmäßige Konsistenz und höhere Reißfestigkeit auf und findet deshalb z. B. als Umblatt bei maschinell hergestellten Zigarillos Verwendung.» - Pfeifentabak:»Pfeifentabak ist geschnittener, loser Tabak. Die Schnittbreite liegt in der Regel zwischen 1,5 und 3,5 mm. Pfeifentabak ist meist stark aromatisiert. Zum Konsum wird der Tabak in eine Pfeife gestopft.»
- Wasserpfeifentabak:»Im Gegensatz zu Pfeifentabak enthält Wasserpfeifentabak einen deutlich höheren Anteil an Feuchthaltemitteln (wie z.B. Glycerin, 1,2-Propylenglykol). Des Weiteren sind die Produkte meist sehr stark aromatisiert. Zum Konsum wird die feuchte Tabakmischung in einer Wasserpfeife verschwelt.»
- Schnupftabak:»Bei Schnupftabak handelt es sich um eine fein gemahlene Mischung aus einer oder mehreren Sorten Tabak, die in kleinen Prisen (circa 30 bis zu 200 mg) in die Nase eingezogen wird. Das Produkt wird nach einer kurzen Verweildauer durch Schnäuzen wieder entfernt. Die Nikotinaufnahme erfolgt über die Nasenschleimhaut. Neben Tabak enthält Schnupftabak auch Zusatzstoffe, unter anderem Feuchthaltemittel (zum Beispiel Paraffinöl) und eine Reihe von Geruchs- und Geschmacksstoffen (zum Beispiel Menthol, Pfefferminzöl, Fruchtessenzen)»
- Kautabak:»Kautabak besteht im Regelfall aus verarbeiteten Tabakblättern, die mit Soßen unterschiedlicher Geschmacksrichtungen durchtränkt werden und anschließend – je nach Machart des Produktes – zu Strängen aufgerollt, zu einem Riegel gepresst oder mit einem Deckblatt zu einem langen Seil versponnen werden. Zum Konsum legt man ein Kautabakstückchen in die Wangenfalte und wenn die Wirkung des Tabaks nachlässt, wird er gekaut.»
- Tabakerzeugnisse zum oralen Gebrauch:»Unter dieser Bezeichnung werden alle Tabakerzeugnissen zum oralen Gebrauch – mit Ausnahme von Erzeugnissen, die zum Inhalieren oder Kauen bestimmt sind – zusammengefasst, Tabakerzeugnisse zum oralen Gebrauch bestehen meist aus feingemahlenem Tabak, dem z. B. noch Wasser, Salze, Feuchthaltemittel und verschiedene Aromastoffe zugesetzt werden. Die Produkte werden lose oder portioniert in kleinen, porösen Zellulosebeutelchen angeboten. Zum Konsum platziert man das Produkt meist unter die Lippe oder in die Wangentasche, wo es dann verbleibt, bis die Nikotinabgabe und damit die Wirkung vorüber ist.»
Quelle: Bayerischen Landesamtes fürGesundheit und Lebensmittelsicherheit
Geschichte des Tabaks
Die Geschichte begann, als 1492 ein Schiff am Horizont auftauchte und weiss häutige Mönner an Land sprangen und die Insel in Besitz nahmen.
Sie schlugen Pfade in die Wälder, bauten Holzpalisaden, trieben Handel, wunderten sich über die Pflanzen, die hier zu rituellen oder Medizinalzwecken gebraucht wurden. Lustig fanden sie die zusammen gerollten Blätter, die zu Festen geraucht wurden und die «tabaco» genannt wurden. Wie alles Wundersame wurden die Pflanzen eingeschifft und weg gebracht, zuerst nach Portugal, dann in andere Länder Europas. Sie glaubten, dass diese Pflanze Heilkräfte besässen, was übrigens bei allen neu entdeckten Pflanzen geschah. Sie versprachen sich Heilung bei Migräne und bald wurde Tabak oder nicotiana tabacum, wie sie bald hiess, ein beliebtes Heilsmittel.
Die Gattung Nicotiana ist in Südamerika, Nordamerkika und Australien einheimisch, gehört zu der Familie der Nachtschattengewächse wie Tomate und Kartoffel; die Gattung wächst vorallem in der gemässigten Klimazone und bevorzugt helle und feuchte Standorte.
Das in der ganzen Pflanze enthaltene Alkaloid Nikotin, das Schutz vor Fressfeinden bietet, ist der Wirkstoff, der beim Inhalieren auf die Hirnzellen wirkt.
Im 19. Jh wurde die erste Maschine zum Herstellen von Zigaretten erfunden, wodurch Zigaretten das Kauen oder Schnupfen von Tabak verdrängten. Rauchen wurde zum Volkssport; obwohl die schädliche Wirkung schon lang bekannt war, wurde erst in den 60 er Jahren des letzen Jahrhunderts wissenschaftliche Studien durch geführt und publiziert. Dies bewirkte, dass der Anteil der Raucher zu sinken begann.
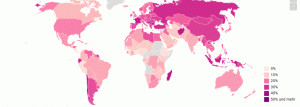
Die Länder mit dem höchsten Raucheranteil sind Serbien, Libanon, Lettland, Slowakei und Afghanistan, hier rauchen zwischen 35 und 40 % der Bevölkerung.
Wirtschaftlich von Bedeutung sind die beiden Arten Nicotiana tabacum und Nicotiana rustica; von beiden Arten existieren unzählige Züchtungen. Verwertet werden die Blätter, die getrocknet, gerollt oder geschnitten werden.
Die Wirkung von Nikotin sei hier zitiert:
«Eine Zigarette enthält bis zu 13 mg Nikotin, davon werden beim Rauchen zwischen 1 und 2 mg pro Zigarette aufgenommen. Bei einem Konsum von 20 Zigaretten pro Tag werden also zwischen 20 und 40 mg Nikotin über den Tag verteilt aufgenommen.
Nikotin erreicht innerhalb weniger Sekunden (ca. 10 Sekunden) nach dem Einatmen das Gehirn, wo es seine Wirkung entfaltet. Die Wirkung erfolgt schneller als bei der Verabreichung einer Injektion. Im Gehirn bindet Nikotin an die sogenannten Acetylcholin-Rezeptoren, das sind für bestimmte biochemische Signalprozesse spezialisierte Bindungsstellen auf den Zellen. Es regt beispielsweise eine Steigerung der Dopamin-Produktion an, was mit einem unmittelbaren Wohlgefühl bzw. dem Gefühl von Beruhigung einher geht. Neben der Anregung dieses Prozesses im sogenannten «Belohnungszentrum» des Gehirns wirkt das Nikotin außerdem anregend auf Hirnareale, die für Wachheit und die Steigerung der Aufmerksamkeitsleistung zuständig sind.
Über die im Gehirn ablaufenden Prozesse wird schließlich eine Aktivierung des sympathischen und parasympathischen Nervensystems angestoßen. Durch die Anregung des Parasympathikus kommt es zu einer Steigerung der Magensaftproduktion, sowie einer verstärkten Darmtätigkeit und damit zur Anregung der Verdauung. Die Aktivierung des Sympathikus führt zur Freisetzung von Adrenalin und damit zu einer Steigerung der Herzfrequenz und dem gesteigerten Abbau von Fetten und Glykogen (Blutzucker). Dadurch wird auch die zu sich genommene Nahrung schneller verstoffwechselt, was einen erhöhten Energieumsatz zur Folge hat. Außerdem wirkt das Nikotin auf das sogenannte «Brechzentrum», d.h. es vermindert den Appetit und ruft Übelkeit hervor.
Durch die vom Nikotin angestoßene Freisetzung von Vasopressin verengen sich die Blutgefäße, was in der Folge zum Ansteigen des Blutdrucks beiträgt. Weiterhin wirkt das Vasopressin antidiuretisch, vermindert also die Harnproduktion und den Harndrang. Nikotin fördert ausserdem die Blutgerinnungsneigung, wodurch sich die Gefahr von Thrombosen erhöht.
Nikotin bewirkt eine Erhöhung der Atemfrequenz und wegen der Übererregung von Druck- und Schmerzrezeptoren auch eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit.
Nachdem es seine Wirkung entfaltet hat, wird das Nikotin über die Leber abgebaut, indem Nikotin zu Cotinin oxidiert und dies schließlich über die Blase ausgeschieden wird. Die Halbwertszeit des Nikotins im Körper beträgt etwa 2 Stunden.
Bereits während Nikotin abgebaut wird, entwickelt sich ein erneutes Rauchverlangen, um die Rezeptoren im Gehirn mit Nachschub zu versorgen und in der Folge das gewünschte Wohlgefühl zu erreichen. Bleibt dieser Nachschub zu lange aus, entwickeln sich unangenehme Entzugssymptome wie Unruhe, Gereiztheit, Unkonzentriertheit, etc..»
Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum
ökologische Fussabdruck
Als kleiner Artikel in der Gratiszeitung war zu lesen, dass heute die globalen Ressourcen für dieses Jahr verbraucht sind; wir beginnen heute auf Pump vom nächten Jahr zu leben.
Um diese Aussage zu verstehen, wird der Begriff ökologischer Fussabruck verwendet.
«Der ökologische Fussabdruck stellt dar, welche natürlichen Ressourcen die Bevölkerung einer Region, eines Landes oder der Welt in Anspruch nimmt, um ihren Bedarf zu decken: Das sind etwa pflanzliche Nahrungsmittel, Pflanzenfasern, die Tierhaltung und Fischprodukte, Holz und Raum für städtische Infrastruktur. Hiermit verbrauchen Menschen produktive Oberflächen: Ackerland, Weideland, Fischereigründe, bebautes Land, Wald sowie Land, das durch Kohlenstoffdioxidausstoss oder -aufnahme belastet wird.
Auf der anderen Seite hat eine Region, ein Land oder die Welt eine gewisse Biokapazität: eine Oberfläche von biologisch produktivem Land oder Wasser, die sich innerhalb einer bestimmten Zeit regenerieren kann. Sowohl der Verbrauch als auch die Oberfläche werden in globalen Hektaren (gha) gemessen: Für jede Hektare geht man von einer jährlichen Bioproduktivität aus, die dem Weltdurchschnitt entspricht. Das macht etwa eine Hektare Weideland (niedrige Produktivität) mit einer Hektare Ackerland (hohe Produktivität) vergleichbar.
Ein Vergleich des Fussabdrucks mit der Biokapazität zeigt, wann die ökologischen Reserven aufgebraucht sind. » (NZZ,
Aktuell stehen pro Person 1,7 gha Biokapazittät zur Verfügung, in der Schweiz werden allerdings 4,6 gha verbraucht, d.h. Anfang Mai sind diese Reserven bereits aufgebraucht, global weltweit gesehen ist dieses Datum Ende Juli erreicht.
Wie nachfolgende Tabelle für Deutschand zeigt, verteilt sich der Fussabdruck auf die 4 Kategorien Ernährung, Wohnen, Mobilität und Konsum.
| Kategorie | Prozentwerte für Deutschland | vorrangig verursacht durch … |
|---|---|---|
| Ernährung | 35 Prozent | tierische Lebensmittel |
| Wohnen | 25 Prozent | Heizenergie |
| Mobilität | 22 Prozent | Verkehrsmittel |
| Konsum | 18 Prozent | Produktkäufe |
In der Schweiz ist der Anteil im Bereich Wohnen höher, da immer noch viel fossile Energie für das Heizen im Winter verwendet wird.
Was könnte man tun?
- Temperatur im Winter etwas senken
- einmal pro Woche auf tierische Nahrung verzichten
- mehr ÖV oder Velo benutzen
- Konsum einschränken
Die Überbeanspruchung der Natur und die Gier des homo sapiens verändert unsere Erde schneller als vorher; Folge ist die Klimerwärmung und mit ihr Verbunden Verlust von wetvollen Landschaften wie Gletschern, Wäldern, Inseln, Mangrovenwälder.
Oder soll die Schweiz mal so aussehen?
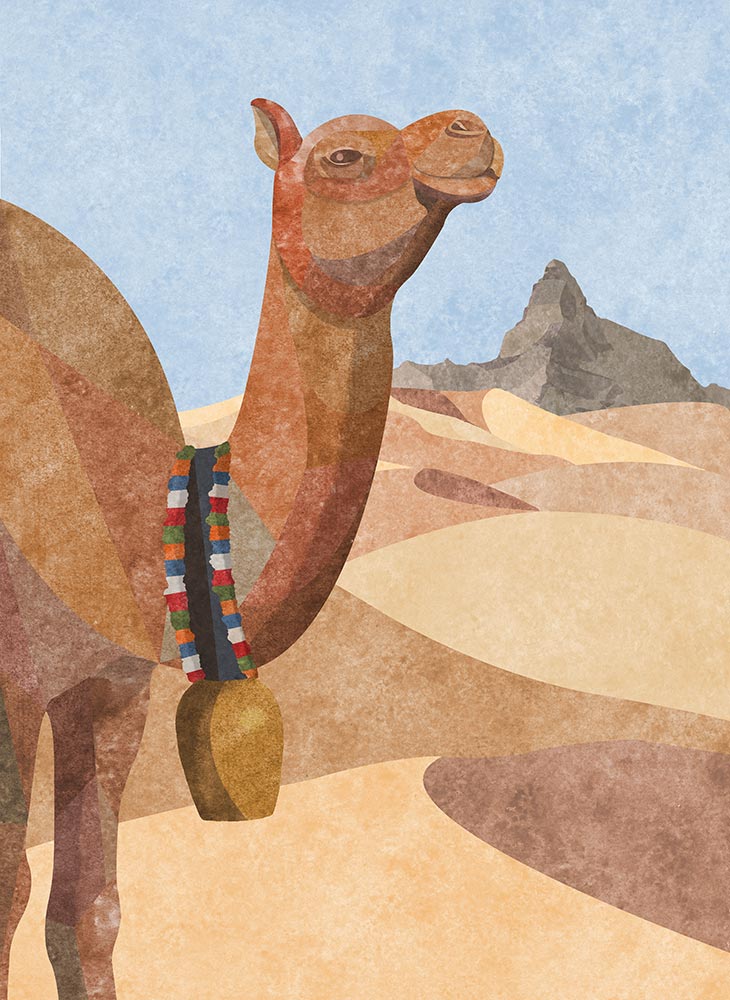 Juliana Aschwanden-Vilaça, Hochschule Luzern – Design & Kunst
Juliana Aschwanden-Vilaça, Hochschule Luzern – Design & Kunst
regnerischer Sonntag
Ein bischen im Bedeutungsschatten der Stadt Zürich liegt Winterthur, gut 20 Minuten mit dem Zug entfernt.
Zu Unrecht wird sie von oben herab angeschaut, Winterthur besitzt ein intensives kulturelles Leben, interessante Museen für Gross und Klein.
Eines der empfehlenswerten Museen ist das Photomuseum; die aktuelle Ausstellung widmet sich der französischen Konzeptkünstlerin Sophie Calle; in den verschieden Säälen werden Auftragsarbeiten gezeigt, u.a.»La dernière image»; in dieser Konzeptarbeit fotografierte und interviewte Calle blinde Menschen in Istanbul, befragte sie nach den letzten visuellen Eindrücken oder den imaginären visuellen Eindrücken. Eine erzählerische Einheit besteht aus dem Portrait des Erzählers, dem Text des Erzählers und dem letzten oder imaginären viusellen Gegenstand des Erzählers.

Eine andere Konzeptarbeit heisst «parce que»; die Idee ist die Umdrehung der Betrachtung von Fotographien; normaler Weise wird ein Foto betrachtet und dann nachher nach den Gründen der Aufnahme gefragt (wenn überhaupt). Sophie Calle zeigt in den Fotorahmen ein schwarzes Tuch, auf dem geschrieben steht, warum sie das dem Betrachter verborgene Bild aufgenommen hat. Der Betrachter kann das Tuch anheben und die darunter liegende Fotographie betrachten.

Eine weiteres Thema heisst «Que voyez-vous?»; hier liess sie in Museen berühmte Bilder z.B. ein Bild Rembrandt entfernen und liess Besucher, Museumsangestellte notieren, was ihnen beim Betrachten des leeren Rahmens einfällt.

An einem regnerischen Sonntag ist der Besuch eine lohnende Alternative, besonders wenn man es noch mit Kaffee und Kuchen bei alten Freunden verbinden kann.
Noch ein Hinweis; man sollte der französischen Sprache mächtig sein.
Regret
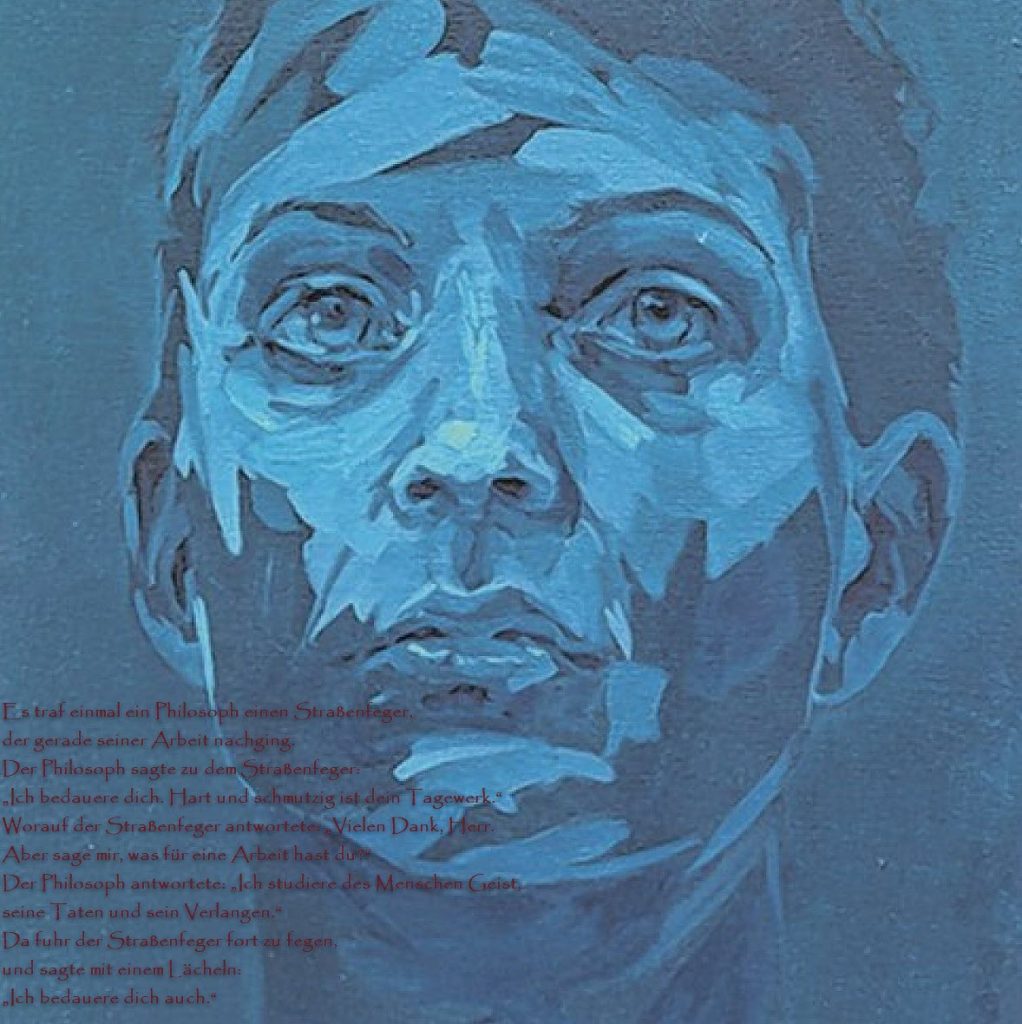
the weakness in me
Der Klimawandel
Ein Freund erzählte mir am Mittagstisch, dass am Mont Blanc auf gut 3000 Meter auf Grund der Klimaerwärmung ein See entstanden sei, gespiesen von geschmolzenen Schnee und Eis.
Ich fragte ihn, wie er denn nach Polen in die Ferien gehe.