Die Vorband war lausig, was eigentlich bei den meisten Konzerten der Fall ist; der Sound war breiig, der Gesang unverständlich und der Musikstil nicht definierbar. Kein Wunder verloren sich nur ein paar dutzend Leute vor die Bühne und versuchten die Band anzufeuern. Nach gut 45 Minuten war dann Schluss und die Halle begann sich für den Hauptakt zu füllen.
Der Sänger betrat pünktlich die Bühne, eingeleitet durch ein Einführungsvideo, obwohl eigentlich alle ihn kannten. Erstaunlicherweise fanden sich auch junge Besucher ein, derweil der Höheflug der damaligen Band in späten neunziger Jahren begann und über ein Jahrzehnt andauerte.
Da stand er nun auf der Bühne und zusammen mit der acht köpfigen Band spielten sie die Stücke seines neusten Albums. Der Sound dieser Songs war etwas monoton, überladen mit fetten Gitarren, gut, dass das Bühnenvideo wirklich cool gemacht war, schnelle Abfolgen der einzelnen Musiker, in einem Retro Stil geschnitten. Das Publikum begann zu schmelzen, als er eingeleitet mit rüpelhaften Sprüchen diese alten, hübschen Oassis Songs aus dem Hut zu zaubern begann: Live forever, Supersonic, Stand by me, Wonderwall und andere. Hier hörte man den Unterschied zu seinen neuen Liedern, diese kommen nicht an diese Klangdichte der alten Band heran, diese verspielten Melodien, die an die Beatles erinnerten. Die Gruppe Oasis läutete damals zusammen mit Blur und Libertimes die sogenannte Britpop Bewegeung ein, ein musikalischer Rückgriff auf die 60 ziger Jahre, mit bunten Harmonien und Riffs.
Das damalige Leben forderte allerdings auch seinen Tribut, die Stimme von Liam Gallagher, die seit jeher einen begrenzten Umfang aufwies, wirkte noch etwas rauher und zerkratzter als früher, was er mit seinem Zugabelied Cigarettes and Alcohol ja auch untermauerte.
Pünkltich wie eine Schweizer Uhr endete dann das Konzert; klar es war schön die alten Songs zu hören und die sehr gute Videoinstallation zu sehen, aber irgendwie fehlte vieles für ein Happening, der Geruch nach Gras zum Beispiel, die Lust der Band zu improvisieren, der Small Talk mit dem Publikum. Es ist dem Zeitgeist entsprechend sauber gespielt, aber etwas steril, so dass schon vor zehn das Publikum wieder dem Bahnhof entgegen strebte.
Kein Vergleich zu den damaligen Konzerten der Stones in Basel, wo irgendwann vor Mitternacht der Extrazug wieder nach Zürich fuhr, gefüllt mit swingenden, glücklichen, bekifften und beschwipsten Fans.
rabbits
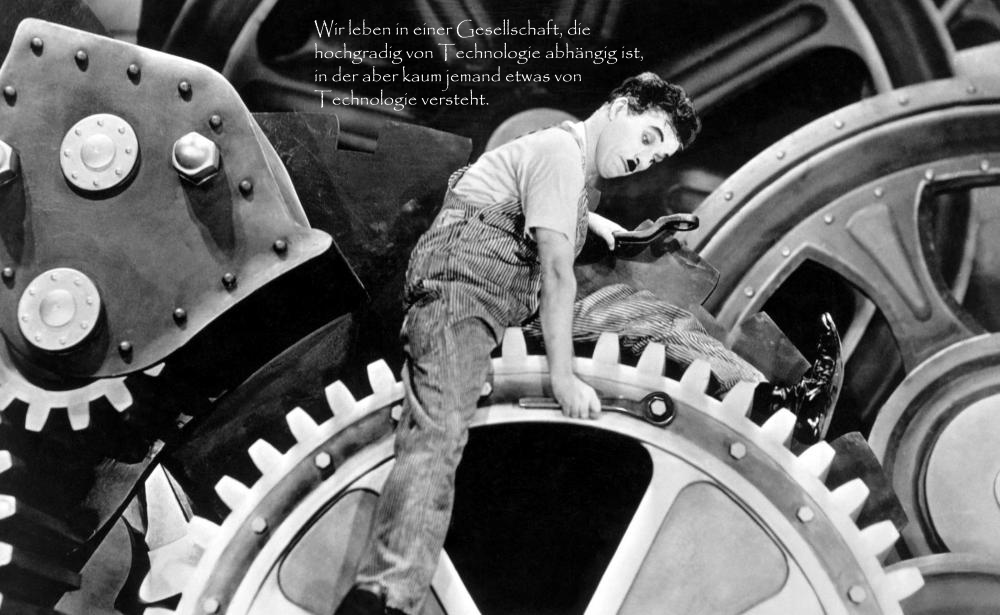
millionarios
Die Landeswährung ist Colones, derweil eigentlich überall der Gringos wegen mit Dollars bezahlt werden kann. 1 Dollar ergibt etwa 570 Colones, was bedeutet, dass man schon mit 2000 Dollars Millionär werden kann.

Das erinnert natürlich wieder an alte Zeiten, wo in Italien für das Geld Tonnen weise Liras verteilt wurden, und man aufpassen musste, dass nicht so ein dummer Telefonjeton im Wechslegeld landete, der einfach zu nichts zu gebrauchen war. Auch in Frankreich gabs für 1 Franken etwa 100 franc, schwierig für die Umrechnerei.
Eindrücklich war das Einlösen der Checks in Indien: da holte der Bankangestellte Bündels von Rupies hervor, die mit Baumwollfäden zusammen genäht waren, die sich nur mühsam aufzwirnen liessen.
Bei den Kreditkarten sieht es viel besser aus, sofern man denn eine Visa Karte besitzt, die Cumulus Mastercard hingegen sollte, gemäss Insiderinfos eigentlich auch akzeptiert werden. Ist doch hübsch, dass da noch Cumulus Punkte aus Costa Rica anfallen.
Pflanzengiesser
Eine Herausforderung, wie es im Management Jargon heisst, einer Reise ist die Frage, wer den in der Abwesenheit die Pflanzen giesst. Die Standardpflanzengiesserin ist sebst unterwegs, wahrscheinlich auf den Galapagos Inseln am Schildkröten zählen, so dass jemand anders gesucht werden muss.
Bürokollegen? Hm, Arbeit ist Arbeit, und Privat ist Privat, wäre nur der letzte Notnagel, wenn sich niemand finden liesse.
Nachbarn? Klar, aber so gut kennen wir uns auch nicht, als dass diese einfach in der Wohnung rein kommen könnten.
Friends? Auf alle Fälle, nur sind diese überall verstreut, und sie werden kaum der Pflanzen wegen nach Zürich kommen.
Da bleibt doch nur die Verwandtschaft. Ein erster Hilfeschrei verhallte ungehört, weswegen zu drastischeren Mitteln gegriffen werden musste. So wurde direkt diese drei unterirdisch netten Nichten angeschrieben, ob sie denn sich der Pflanzen erbarmen und ein bischen ihnen Händchen halten würden.
«Ladies, kann jemand von Euch den Dschungel im April giessen? Shiyun klebt in Suedamerika und fällt aus. Wäre super.»
M: «Also im April bedeutet? Wie lange? Wie oft? Tiere füttern kann ich nicht…die sterben bei mir in der Regel.»
S: «Pflanzen sterben bei dir eher auch…»
Si: «Jop kann ich bestätigen»
«Belohnung eine Flasche Wein, oder seid ihr teurer?»
«1 mal pro Wochenende, vom 1.4. bis 21.4., sagen wir 2 Flaschen Wein?»
M: «Also jede von uns einmal. Das macht dann 6 Flaschen Wein…»
«Hm, gehe dann mal zum Aldi….»
Die Kakteen und die anderen Trocken resistenten Pflanzen werden es überleben, aber diese durstigen Tropenpfanzen werden wahrscheinlich den Ladies zum Opfer fallen. Friede ihrer Seele.
management’s dreams
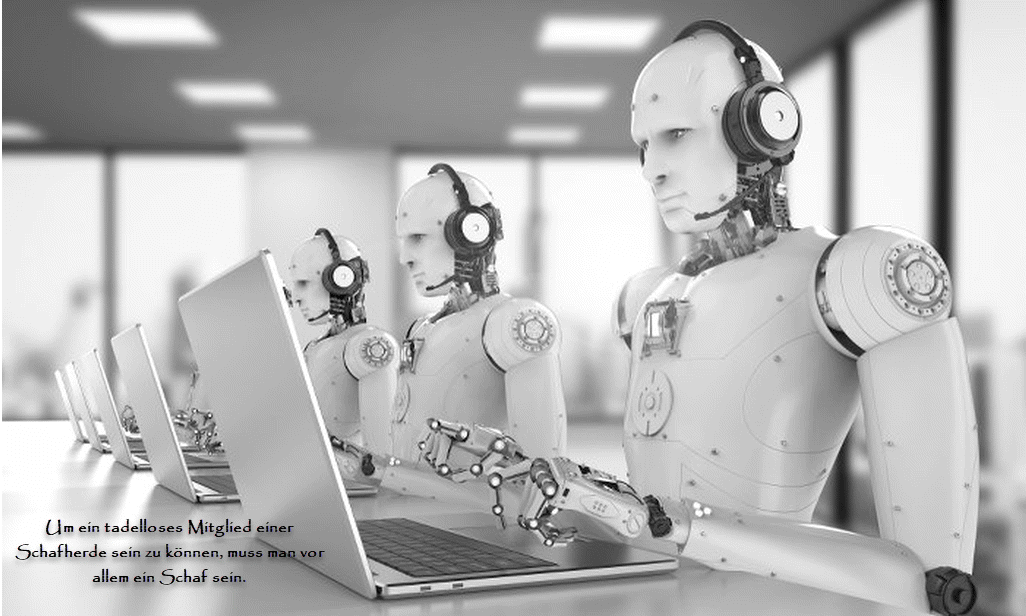
Mäzenatentum
Ein Mäzen von nationaler Bedeutung war Oscar Reinhart, Sohn eines Handelshauses aus Winterthur, das mit dem Import von Baumwolle für die heimische Textilindustrie zu Vermögen gekommen war.
Sein Interesse galt der impressionistischen Malerei, und so entstand im Verlauf der Zeit eine imposante Sammlung der wichtigsten Malern aus dieser Kulturepoche, die nach dem Tod von Oscar Reinhart dem Staat übergeben wurde.
Die Villa auf dem Römerholz in Winterthur umfasst nicht nur die Sammlung mit Werken von Monet, Cézannes, Renoir, van Gogh, Picasso, Breughel und anderen, sondern auch eine grosszüge Gartenanlage mit Plastiken, Teichen und Hecken.
les muets

Multi Kultî
Die Lifttüre stand noch offen, als um die Ecke 2 Damen bogen, vermutlich Mutter und Tochter, und sich beeilten, den Lift zu errreichen. Sie bedankten sich, traten ein und setzten ihr Gespräch in einer fremden Sprache fort.
«Welche Sprache sprechen Sie?»
«Vietnamesisch»
«Habe ich nicht erkannt»
Beim Aussteigen winkten sie einen schönen Abend und verschwanden in der Dunkelheit.
Diese Ecke des Quartiers scheint wirklich ein Muti Kulti Hotspot zu sein; in der Ladenzeile neben dem Lift sind jetzt auch die beiden leer stehenden Lokale vermietet, ein Osteuropäischer Lebensmittelladen und ein Coiffeursalon versuchen hier ihr Glück neben dem indischen Lebensmittelladen, dem Kioskbetreiber aus Osteuropa, dem leeren Internetcafé und den beiden Restaurants.
Auch im Mietshaus herrscht ein Sprachgewirr, nebenan wohnen Mutter und erwachsener Sohn aus Thailand, unten streitet sich ein afrikanisches Päärchen in einer fremde Sprache, im Erdgeschoss lebt eine Familie aus Sri Lanka mit den beiden Kindern; das grössere Mädchen besucht bereits die Schule und singt manchmal Schweizerdeutsche Kinderlieder im Garten. Unter dem Dach wohnt eine Studentin aus dem Kanton Tessin, nebenan gab es lange Zeit eine Studenten WG, die jeweils auf dem Balkon ihre Feste feierten.
Es ist nicht anzunhemen, dass diese Familien aus Romantik in diesem lauten, lärmigen Quartier wohnen, sondern schlicht deswegen, weil die Mietpreise hier noch bezahlbar sind; es ist auch nicht zu vermuten, dass sich diese Menschen freiwillig in der Freizeit begegnen, weil sie sich doch nicht verstehen können.
Kaffe und Bananen
Wenn gefragt wird, was über Costa Rica bekannt ist, ist es vielleicht zuerst «keine Armee», und dann höchstens noch «Kaffee und Bananen».
Tatsächlich waren diese beiden Produkte fast 150 Jahre lang die Haupteinnahmequelle des Landes; Kaffee wurde und wird im Hochland angebaut, Bananen an der Pazifikküste. Da die Absatzmärkte die USA und Europa sind, wurde eine Eisenbahnlinie von der Pazifikküste nach Puerto Limon erstellt, um von dort die Produkte mit dem berühmten Bananendampfer zu verschiffen. Allerdings verschüttete ein Erdbeben vor gut 20 Jahren die Schienen, wodurch sich der Transport wieder auf die Strasse verlagert hat.
Heute sind Bananen und Kaffee immer noch wichtig, allerdings haben die Einnahmen des Tourismus die der Landwirtschaft deutlich in den Schatten gestellt.
Hier ein paar Fakten zum Land:
«Costa Rica hat 4,27 Millionen Einwohner. Weiße und Mestizen stellen 94 Prozent der Bevölkerung, vier Prozent sind Afro-Costaricaner, Mulatten, Chinesen etc.; der Anteil indigener Gruppen beträgt nur zwei Prozent. Die Ureinwohner wurden zumeist von den spanischen Eroberern ermordet oder fielen ingeschleppten Krankheiten zum Opfer. Costa Rica ist eine Präsidialrepublik, der Präsident und zwei Vizepräsidenten werden auf vier Jahre gewählt. Volksvertretung ist die ebenfalls für vier Jahre ewählte Assembla Nacional. 1983 erklärte sich Costa Rica politisch neutral; Gewaltenteilung, Menschenrechte und das Verbot der Aufstellung einer Armee sind in der Verfassung verankert. Für die innere Sicherheit sind bewaffnete, mit Helikoptern, Flugzeugen und Schnellbooten ausgestattete Polizeikräfte zuständig.»
«Kaffee ist die berühmteste Kulturpflanze des zentralamerikanischen Landes. Im 19. Jahrhundert begründete sie den Reichtum Costa Ricas. 1843 begann der Export nach England, dank der Einnahmen konnten öffentliche Bauten, Theater, Schulen und Universitäten errichtet werden. Kaffee findet auf den fruchtbaren Vulkanböden ideale Wuchsbedingungen; in den Anbaugebieten ist es tagsüber heiß, nachts kühl; die Sommer sind regenreich, die Winter trocken. Die umweltbewussten Kaffeebauern Costa Ricas profitieren derzeit von der Nachfrage nach ökologisch gewachsenem Kaffee. Vor allem in Europa und den USA ist pestizidfreier, handgepflückter Hochlandkaffee gefragt. Große Konzerne wie Nestlé kooperieren daher mit Umweltschutzorganisationen wie „Rainforest Alliance“, die Kleinbauern berät. Schließlich profitieren beiden Seiten: Die Großunternehmen machen Gewinne mit dem begehrten sustainable coffee, die Bauern sichern ihre Existenz. Gerade für Kaffeekooperativen in Costa Rica spielt der faire Handel eine wichtige Rolle. Fair Trade berücksichtigt die Interessen der Erzeuger, garantiert längerfristige Verträge und feste Abnehmerpreise.» Siehe auch Planet Wissen Kaffee

«Bananen sind ein wichtiges Exportgut Costa Ricas. 2007 wurden etwa 120 Millionen 18-Kilogramm-Behälter im Wert von 700 Millionen US Dollar verschifft. In den letzten Jahren hat sich in der Lateinamerikanischen Bananenproduktion ein tief greifender Wandel vollzogen. Früchtekonzerne wie Dole, Chiquita und Del Monte, die früher in den „Bananenrepubliken“ nach Gutdünken handelten, Naturzerstörung betrieben, Arbeiter drangsalierten und so manches Gewaltregime mit Finanzspritzen am Leben hielten, unterstützen heute eine sozial verantwortliche und umweltverträgliche Produktion. Einer der wichtigsten Gründe für den Umschwung ist wohl der permanente Rückgang der Erwerbsbevölkerung auf dem Land. Viele Arbeiter zieht es in die Städte und Industrieregionen, vor allem junge Menschen wandern ab. Die Belegschaften lassen sich vielerorts nur mehr durch bessere Bezahlung und attraktivere Arbeitsbedingungen auf den Plantagen halten. Außerdem reagieren die Früchtekonzerne auf den Druck der Verbraucher in Europa und den USA, die „saubere“ Produkte fordern und nach der Erkenntnis von Marktforschern sogar bereit sind, höhere Preise dafür zu bezahlen. Die Bananenfarmen des Konzerns Dole sind mittlerweile nach dem internationalen Social Accountability Standard (SA 8000) zertifiziert.» Siehe auch Planet Wissen Banane
 Die Bananengewächse sind übrigens ursprünglich in Südostasien beheimatet und der Kaffeestrauch stammt aus Afrika.
Die Bananengewächse sind übrigens ursprünglich in Südostasien beheimatet und der Kaffeestrauch stammt aus Afrika.
Badetuch und Zahnbürste
Dank der Digitalisierung erscheint die Welt als Dorf, d.h. im Gegensatz zum Vorinternetzeitalter ist eine Reise quasi vom Bürostuhl planbar. Vorbei auch die Zeiten, wo der lonely planet Band in der Buchhandlung gesucht wurde mit den geheimen lonely planet Tips für Reisende, die dann doch keine Geheimtips waren, weil ja alle lonely planet lasen und zu diesem Geheimtip gingen. Klar, es gibt diese Buchreihen immer noch, modernisiert, und immer noch mit den Abschnitten places to stay, places to eat, places to buy etc, etc. Allerdings reist der moderne Reisende eher im Rollkofer statt im Tramperrucksack, bucht übers Samrtphone das nächste Hotelzimmer oder RB&B statt den Weg nach dem tourist office zu fragen oder die Liste mit den billigen Hotels abzuklappern. Irgendwie ist dadurch Reisen viel sicherer geworden, bzw. das Vertrauen in die fremde Umgebung wird grösser, weil halt alles schon digital angeschaut und gebucht werden kann; ganz zu schweigen von den Sprachapps, wodurch die Kommunikation mit der einheimischen Bevölkerung theoretisch möglich wäre, sofern sie Siri und Konsorten denn auch verstehen würden. Ja, wer will nicht mal im tiefsten Afrika in Suaheli dem hungrigen Löwen mitteilen, dass er Tourist sei und bitte nicht gefressen werden will.
Wenn man sich durch die einschlägigen Seiten durchackert, was denn so mitgenommen werden muss, liest man: Mückenspray, Regenschutz, feste Schuhe, Sonnencrème, Kopfschutz (wohl der berühmte Tropenhelm), Regenschutz, Imodium (wohl gegen zuviel Reis mit Bohnen), warme Kleider fürs Hochland, Malariaprophylaxe vorallem, wenn der Dschugel erforscht werden sollte. Geblfieber und all diese Wurmparasiten sind zwar auch mühsam, werden aber nicht explizit erwähnt. Bei Malaria genügt offenbar, dass vor Ort bei einem Verdachtsmoment eine Tablette geschluckt wird, kein Vergleich zu anno domini, wo drei Monate vorher mit der Einnahme begonnen werden musste, was zwar, wie die Inder versicherten, schon etwas des Guten zuviel gewesen sei, aber immerhin Geld in die Kasse der Pharmafirma gespült hat.
Wie romantisch war es doch, als das Geld knapp war und das Bild von Badetuch und Zahnbürste als einziges Gepäckstück durch die Runde geisterte; nun, jetzt mit dem pralleren Portemonnaie liegt doch immerhin ein zweites Badetuch drin.
Ein Ding der aktuellen Moderne sind die sozialen Medien, wo die Zuhause Gebliebenen quasi live mitverfolgen können, wie der Toruist sich wagemutig einen Wasserfall hinunter stürzt, in den geöffneten Rachen eines Krokodils starrt oder sich von einer Boa constricta umgarnen lässt. Tja, da muss sich der Schreibende leider selber auch ein bischen an der Nase nehmen und Zähne knirschend eigenstehen, dass er nicht viel besser ist, Asche über das Haupt.
